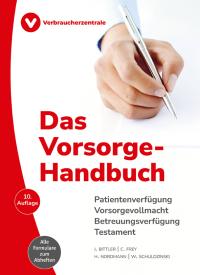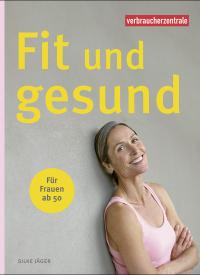Kinder müssen dann entweder ebenfalls in der privaten Krankenversicherung versichert werden, oder aber freiwilliges Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung werden. Die Kosten für eine freiwillige Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung liegen mit rund 250 Euro ähnlich hoch oder geringfügig höher als eine private Krankenversicherung für Kinder.
Der Ausschluss von der Familienversicherung greift nur, wenn tatsächlich alle drei Bedingungen erfüllt sind. Ist beispielsweise der Vater privat und die Mutter gesetzlich versichert, verdient sie aber mehr als ihr Ehemann, können die Kinder trotzdem familienversichert werden.
Die Gesamtbetrachtung beider Eltern findet aber nur statt, wenn beide verheiratet oder nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz verbunden sind. Sind beide Eltern nicht verheiratet, kann das Kind sowohl über den privat als auch über den gesetzlich versicherten Elternteil versichert werden.
Weiterversicherung nach Ende der Familienversicherung
Nach dem Ende der Familienversicherung sind Betroffene automatisch weiterhin freiwillig gesetzlich krankenversichert, sofern keine andere Pflichtversicherung greift. Versicherte können jedoch innerhalb von zwei Wochen nach dem Hinweis der Krankenkasse ihren Austritt erklären, sofern sie eine anderweitige Absicherung im Krankheitsfall nachweisen können – zum Beispiel eine private Krankenversicherung.
So berechnen sich Beiträge für Pflichtversicherte und freiwillig Versicherte
Gesetzlich Pflichtversicherte müssen von ihrem Lohn einen prozentualen Anteil von 14,6 Prozent an die Krankenkasse zahlen. Die Hälfte davon übernimmt der Arbeitgeber. Dazu kommt noch der kassenindividuelle Zusatzbeitrag, der im Durchschnitt 2,5 Prozent beträgt, je nach Krankenkasse aber unterschiedlich ausfallen kann.
Für die Pflegepflichtversicherung zahlen Eltern mit einem Kind 3,6 Prozent und Kinderlose 4,2 Prozent.
Vom zweiten bis zum fünften Kind wird der Beitragssatz um je 0,25 Prozent reduziert. Als "Kind" zählen Kinder bis zum vollendeten 25. Lebensjahr. Durch die Ermäßigung kommt es jedoch lediglich zu einer Reduzierung des Arbeitnehmeranteils. Der Arbeitgeber muss nach wie vor die Hälfte des allgemeinen Beitragssatzes zahlen. Am Extraaufschlag Kinderlose muss er sich nicht beteiligen.
Bei freiwillig gesetzlich Versicherten wird demgegenüber nicht nur der Verdienst aus einer Anstellung oder aus einer selbstständigen Tätigkeit für die Beiträge herangezogen, sondern die gesamte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Dazu gehören auch Renten, Versorgungsbezüge und alle weiteren Einnahmen und Geldmittel aus Vermietung und Verpachtung sowie Kapitaleinkünfte.
Die Höchstgrenze der zu berücksichtigenden Einnahmen ist für Pflichtversicherte und freiwillig Versicherte gleich. Die Einnahmen der Versicherten werden 2025 maximal bis zu 5.512,50 Euro monatlich für die Berechnung der Beiträge herangezogen.
Beim Mindesteinkommen gibt es jedoch Unterschiede. Pflichtversicherte zahlen ihren prozentualen Anteil auf ihr Arbeitsentgelt, egal wie niedrig das ist. Für freiwillig Versicherte gilt 2025 jedoch ein Mindesteinkommen von 1.248,33 Euro, auch wenn tatsächlich niedrigere Einnahmen erzielt werden.
Unterschiedliche Beiträge je nach Familienkonstellation
Sind beide Elternteile gesetzlich versichert – gleich ob pflichtversichert oder freiwillig versichert – zahlen sie nur die Beiträge aus ihren eigenen Einnahmen.
Bei freiwillig gesetzlich Versicherten, deren Ehe- oder Lebenspartner:innen (nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz) privat krankenversichert sind, wird das Einkommen von Ehe- oder Lebenspartner:innen zu den eigenen Einnahmen dazugerechnet und der Berechnung der Beiträge zugrunde gelegt werden.
Dabei werden zunächst (sofern vorhanden) eigene Einnahmen des freiwillig versicherten Partners berücksichtigt und dann die Hälfte der Einnahmen des Ehe- bzw. Lebenspartners, diese jedoch höchstens bis zur halben Beitragsbemessungsgrenze. 2025 liegt diese Grenze bei 2.756,25 Euro.
Unter bestimmten Voraussetzungen gilt das jedoch nicht. Die wichtigsten Gründe sind:
- Das freiwillige Mitglied verdient selbst mehr als die halbe Beitragsbemessungsgrenze oder mehr als der Ehe- bzw. Lebenspartner.
- Bei dauernd getrennt lebenden Ehepartnern. Dafür werden unter anderem Unterhaltszahlungen verbeitragt.